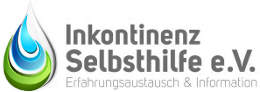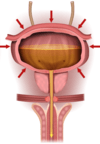 Was ist Dranginkontinenz?
Was ist Dranginkontinenz?
Die Dranginkontinenz ist durch plötzlich auftretenden, sehr starken, nicht beherrschbaren Harndrang mit anschließendem unwillkürlichen Harnabgang charakterisiert.
Die Drangsymptomatik resultiert aus einer Überaktivität oder aus einer zu großen Empfindlichkeit der Harnblase. Deshalb auch die Bezeichnung "Überaktive Blase".
Bei der Dranginkontinenz liegt keine Störung des Verschlussmechanismus vor. Durch das willentlich nicht zu beeinflussende Zusammenziehen des Blasenmuskels, kommt es zum Urinverlust.
Unterschieden wird die Drangsymptomatik in:
- Pollakisurie (mehr als acht Miktionen / 24 Stunden)
- Imperativen Harndrang (Harnverlust durch nicht kontrollierbaren Drang).
- Nykturie (Aufwachen durch Harndrang und Blasenentleerung in der Nacht).
Eine Kombination der Symptome ist möglich.
Unterschiedliche Formen der Dranginkontinenz
Sensorische Dranginkontinenz
Die Wahrnehmung über den Stand der Blasenfüllung ist gestört.
Motorische Dranginkontinenz
Die Nervenimpulse zum Musculus detrusor (der für die Entleerung zuständige Harnblasenmuskel) sind gestört oder geschädigt. Eine vorzeitige, manchmal krampfartigen Detrusor-Kontraktion (Zusammenziehen des Schließmukels) ist die Folge. Der medizinische Fachbegriff lautet: Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (DSD)
Bei der Dranginkontinenz liegt keine Störung des Verschlussmechanismus vor. Dranginkontinenz kann allerdings in Kombination mit Belastungsinkontinenz auftreten. Dies wird als Mischinkontinenz bezeichnet.
Ursachen der Dranginkontinenz
Entzündungen der unteren Harnwege (Harnblase, Harnröhre) und obstruktive (einengenden) Veränderungen der Harnröhre (Harnröhrenstriktur) können auslösend für eine Dranginkontinenz sein.
Gut- und bösartige erkrankungen der Prostata sind Hauptursache der Dranginkontinenz unter Männern. Neurologische Krankheiten schädigen Nerven, reduzieren, erschweren oder verhindern die Signalübertraung zwischen Blase und Gehirn.
Sensorischen Dranginkontinenz ist oft geprägt von Blasenentzündungen (chronisch).Auch Blasensteine können verantwortlich sein.
Die Rezeptoren, die den Füllungsgrad der Blase an das Gehirn melden, sind überempfindlich. Das Gehirn veranlasst daraufhin, über willentlich nicht zu beeinflussende Signale, ein Zusammenziehen der Blasenmuskulatur. Es kommt zur Inkontinenz. Meist werden dabei nur kleine Urinmengen ausgeschieden, allerdings recht häufig.
Bei der motorischen Dranginkontinenz (auch neuropathische Blase) fehlt eine Hemmung der Signale zwischen Blase und Gehirn. Bei der motorischen Dranginkontinenz geht unwillkürlich Harn aus der Harnröhre ab, weil sich der Muskel, der für die Entleerung der Harnblase zuständig ist - der Detrusor - zusammenzieht.
Diese Muskelkontraktionen sind nicht unterdrückbar und führen zu einer Drucksteigerung innerhalb der Harnblase. Genau diese Drucksteigerung spürt man und muss dem Druck unmittelbar nachgeben, d. h. man muss sofort eine Toilette aufsuchen.
Ursachen der motorischen Dranginkontinenz sind meist neurologische Erkankungen wie z.B.: Multiple Sklerose, Schlaganfall, Alzheimer, Parkinson, Folge von Diabetes.
Diagnostik der Dranginkontinenz
Bei vielen inkontinenten Frauen liegt eine Mischform aus Dranginkontinenz und Belastungsinkontinenz vor.
Gynäkologische Untersuchung
Dabei wird geprüft, ob sich Gebärmutter und Scheide gesenkt haben; es wird untersucht, ob ein Oestrogenmangel vorliegt; es wird die Beschaffenheit des Beckenbodens beurteilt.
Harnuntersuchung zum Ausschluß einer Blasenentzündung
Ultraschalluntersuchung
Im Ultraschallbild sind Füllungsvermögen und Füllungszustand der Blase erkennbar. Es können mit einem speziellen Schallkopf vom Scheideneingang aus, die Harnblase und die Harnröhre, sowie ihre Lage zueinander festgestellt werden. Es kann überprüft werden wie sich diese Lage z.B. beim Husten oder Pressen verändert. Diese dynamischen Veränderungen zwischen der Ruhe - und der Belastungssituation können im Ultraschall direkt verfolgt und aufgezeichnet werden. So erhält man wichtige Hinweise auf die therapeutischen Möglichkeiten.
Blasendruckmessung - Urodynamik
Mit dieser Methode werden die Druckverhältnisse in Blase und Harnröhre gemessen. Dadurch kann festgestellt werden, wo die Ursachen für den unwillkürlichen Harnverlust liegen.
Röntgenuntersuchungen zur Diagnostik der Inkontinenz werden - dank der Fortschritte in der Ultraschalldiagnostik - nur noch bei einem kleinen Teil der Betroffenen durchgeführt
Eine gezielte Anamnese (Medikamentenanamnese, bisherige Therapie, Infekt- und Sexualanamnese) ist bei allen Inkontinenzformen sinnvoll.
Im Einzelfall nützliche Diagnostik
Weiterführende Infektdiagnostik, neuropsychiatrische Abklärung, Urethro- Zystoskopie, neurologischer Status.
Behandlung der Dranginkontinenz
Behandlung mit Medikamenten, welche die Überaktivität der Blasenmuskulatur bzw. der Blasenverschlußmuskeln dämpfen. Dadurch erhöht sich die Blasenkapazität und die Blase kann wirklich voll werden, bevor der Drang zum Wasserlassen entsteht. Antibiotische Behandlung bei bestehenden Infektionen.
Blasentraining
- Vergrößerung des Füllungsvolumens der Blase (Verhaltenstraining, Toilettentraining=
- Gefühl für Blase vermitteln
Informationsvideo