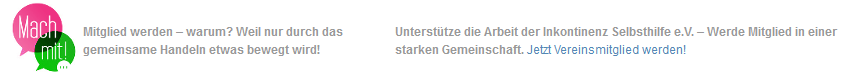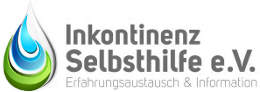- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
- Verein
Öffentlichkeitsarbeit
Förderer & Spender
- Forum
Neueste Forenbeiträge
-
-

- Seltsamer Harndrang (1 Beiträge)
- von Rocker 683
- 26 Apr 2024 00:56
-
-
-

- Senkungen der Gebärmutter, Blase und Mastdarm (14 Beiträge)
- von MichaelDah
- 26 Apr 2024 00:00
-
-
-

- Sakralschrittmacher keine funktion (3 Beiträge)
- von MichaelDah
- 25 Apr 2024 23:12
-
-
-

- Erfahrungen mit Spasmolytika zur Therapie der überaktiven Blase? (7 Beiträge)
- von Poseidon
- 25 Apr 2024 20:33
-
-
-

- Wie mit nächtlichem Harndrang (Nykturie) umgehen? (10 Beiträge)
- von Poseidon
- 25 Apr 2024 20:00
-
-
-

- Aw: Vaginalfistel - Blasen Scheiden Fistel (8 Beiträge)
- von Jessi82
- 25 Apr 2024 17:09
-
-
- Inkontinenz
Inkontinenzhilfsmittel
- Blog | Info
Inkontinenz Forum
Erfahrungsaustausch ✓ | Interessenvertretung ✓ | Information ✓ | Beratung ✓ ► Austausch im Inkontinenz Forum.
Neueste Forenbeiträge
-
-

- Seltsamer Harndrang (1 Beiträge)
- von Rocker 683
- 26 Apr 2024 00:56
-
-
-

- Senkungen der Gebärmutter, Blase und Mastdarm (14 Beiträge)
- von MichaelDah
- 26 Apr 2024 00:00
-
-
-

- Sakralschrittmacher keine funktion (3 Beiträge)
- von MichaelDah
- 25 Apr 2024 23:12
-
-
-

- Erfahrungen mit Spasmolytika zur Therapie der überaktiven Blase? (7 Beiträge)
- von Poseidon
- 25 Apr 2024 20:33
-
-
-

- Wie mit nächtlichem Harndrang (Nykturie) umgehen? (10 Beiträge)
- von Poseidon
- 25 Apr 2024 20:00
-
-
-

- Aw: Vaginalfistel - Blasen Scheiden Fistel (8 Beiträge)
- von Jessi82
- 25 Apr 2024 17:09
-
Registrierung
Noch kein Benutzerkonto? Jetzt kostenfrei registrieren
(Die Freischaltung kann bis zu 36 Stunden dauern)
- Inkontinenz Forum
- Inkontinenz Forum - Harninkontinenz - Stuhlinkontinenz - Hilfsmittel
- Forum: Allgemeines zur Inkontinenz
- Heilkräuter
Heilkräuter
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

Nachdem an verschiedenen Stellen im Forum immer wieder auf diverse Heilkräuter verwiesen wird, möchte ich diesen Thread nutzen, hier einige Heilkräuter vorzustellen und zu diskutieren. Mich persönlich interessiert auch immer der botanische und historische Hintergrund und ich beginne heute mit der Zistrose:
Zistrose – Cistus sp.
Die Zistrosen gehören zu der Gruppe der Rosiden, Ordnung Malvenartige, Familie Zistrosengewächse (Cistaceae) und sind mit etwa 20 Arten im Mittelmeerraum und auf den Kanarischen Inseln vertreten.
Als Heilpflanze finden folgende Arten Verwendung:
Kretische Zistrose – Cistus creticus
Lack-Zistrose – Cistus ladanifer
Graubehaarte Zistrose – Cistus incanus
Das aus Zistrosen gewonnene Harz wurde bereits in der Zeit vor Christus verwendet. In der Bibel finden sich Hinweise in der Genesis 37,25 und 43,11. In den Geschichten um Josef wird eine Karawane erwähnt, die mit Tragakant, Mastix und Ladanum beladen war. Es werden Geschenke erwähnt, die sich aus Mastix, Honig, Tragakant und Ladanum sowie Pistazien und Mandeln zusammensetzten.
Ladanum ist etymologisch vom syrisch-phönizischen Wort „Ladan“ abgeleitet, was so viel wie „klebriges Kraut“ bedeutet und bezeichnet das aus Zistrosen gewonnen Harz.
Tragakant ist die Bezeichnung des Exsudats aus Stämmen und Zweigen des Tragants (Astragalus), welches als gummiartiges Verdickungsmittel für Lebensmittel bis in die Neuzeit als E 413 Traganth Verwendung findet.
Pedanios Dioskurides, ein berühmter Pharmakolge, der unter dem Kaiser Claudius als Militärarzt lebte, beschrieb im ersten Jahrhundert nach Christus in seiner „Materia Medica“ 813 pflanzliche Arzneimittel, darunter auch das Ladanum.
Zistrosen sind ein Charaktergewächs der Macchia und insbesondere der Garigue. Die Garigue ist als Degeneratinsform der Macchie durch Beweidung und Brände zu verstehen. Beides überstehen die Wurzelstöcke der Zistrosen.
Plinius der Ältere beschrieb ebenfalls im 1. Jahrhundert nach Christus die Gewinnung des Harzes mi Hilfe von Ziegen. Diese wurden durch die dichten Zistrosengebüsche getrieben. Das klebrige Harz der Zistrosen blieb an den Ziegenhaaren hängen, welche dann abgeschnitten und ausgekocht wurden. Im erkalteten Überstand konnte das wertvolle Harz abgeschöpft werden.
Ladanum, auch Labdanum benannt, wurde als Schönheitsmittel, aber auch als Räucherwerk zur Desinfektion verwendet. Es wurde aus verschiedenen Arten der Zistrose, wohl vor allem aus der Kretischen Zistrose hergestellt. Heute wird Ladanum meist aus der Lack-Zistrose, welche im westlichen Mittelmeergebiet kultiviert wird, gewonnen.
Aber auch getrocknete Pflanzenteile aus Cistus incanus werden als gesundheitsfördernde Teezubereitungen oder gar in Form von Kapseln verwendet.
Diese Heilpflanze ist gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt von Polyphenolen und der damit antioxidativen Wirkung.
Cistus incanus wird als antibakteriell, entzündungshemmend, fungizid und antiviral beschrieben und findet Verwendung bei Hautkrankheiten, Akne, Atemwegsinfekten, zur Unterstützung der allgemeine Immunabwehr, bei Erkrankungen des Urogenitaltraktes bis hin zu Herpes simplex Infektionen.
Der vielfältige Einsatz hat die Pflanze zu einem Polychrest (aus dem Griechischen poly „viel“ chrestos „nützlich“) hochstilisiert, was unweigerlich auch die Kritiker und Skeptiker auf den Plan gerufen hat. Wie bei allen Heilpflanzen ist die übersteigerte Erwartung als universelles Wunderheilmittel nicht angebracht und so können Erwartungen bei Verwendung von Cistus incanus gegen Vogelgrippe, Gürtelrose oder gar HIV nicht erfüllt werden.
Der Einsatz von Heilkräutern ist aber als Unterstützung des Immunsystems durchaus zielführend und so sehe ich Zistrosentee bei der Behandlung diverser Leiden als eine gute Ergänzung zu anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Account auf eigenen Wunsch gelöscht
-

- Offline
- Benutzer ist gesperrt
-

- Beiträge: 337
- Dank erhalten: 39
gut, daß Du Dich so gut mit Heilkräutern auskennst. Kennst Du auch ein Heilkraut das gegen Blasenreizung hilft?
Danke Dir, liebe Grüße
Dezember
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
probier es doch mit der Zistrose, dieser Tee ist auch wirksam bei diversen Urogenital-Problemen beschrieben. Aber nicht ausschliesslich diesen Tee trinken, immer mal wechseln von Tag zu Tag, empfehlenswert ist auch der Griechische Bergtee und Rotbusch-Tee, da dieser sehr entspannend ist.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- FrauMummel
-

- Offline
- Junior Member
-

- Beiträge: 38
- Dank erhalten: 20
LG
Alex
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
Griechischer Bergtee – Sideritis sp.
Familie Lippenblütler - Lamiaceae
Die Gattung Sideritis ist mit ca. 140 Arten von Makaronesien über die Mittelmeerländer bis Russland, Tibet und West-China verbreitet. Mehrere Arten werden unter dem Namen „Griechischer Bergtee“ verwendet.
Betrachtet man die Etymologie und alte Arzneipflanzenkunde von Sideritis führt dies vorerst zu botanischer Verwirrung, denn Sideritis leitet sich vom lateinischen Wort Eisen ab und als Eisenkraut werden verschiedene Pflanzen unterschiedlicher Gattungen bezeichnet.
Plinius der Ältere (1. JH n. Christus) beschrieb Sideritis zur Verwendung bei Hieb- und Stichwunden durch Eisenwaffen, römische Gladiatoren trugen das Kraut als Amulett.
In alten Arzneimittelbüchern werden unterschiedliche Pflanzen als Herba Sideritidis angeführt. So wird unter der Drogenbezeichnung „Siderititis herba“ Sideritis hirsuta synonym Stachys recta genannt. Stachys recta, der Aufrecht-Ziest, wie er botanisch korrekt heißt, wurde als Ersatz für die echte Droge Sideritis hirsuta aus dem Mittelmeergebiet verwendet. Daher decken sich die Bezeichnungen beider Pflanzen.
Sideritis clandestina hingegen bezeichnet die Drogenbezeichnung „Griechischer Bergtee“. Aber auch die Drogenbezeichnung Herba siderititis scardicae verweist auf Sideritis scardiaca, die Art, aus der heute oftmals „Griechischer Bergtee“ produziert wird. In manchen Bezeichnungen wird diese Drogenbezeichnung auch „Püringer Tee“ genannt, welcher wiederum mit Stachys recta gleichzusetzen ist.
Auch der deutsche Name „Eisenkraut“ wird für unterschiedliche Pflanzen verwendet, denen ähnliche Heilkräfte zugeschrieben wurden: Sideritis, Galium, Verbena und Stachys. Im Altertum wurde Galium unter der Türschwelle zur Abwehr von Bösem vergraben und der als „Vusperkraut“ bezeichnete Ziest fand bei verschiedenen Krankheiten der Zahnwurzel und des Kopfes sowie bei Gelenkserkrankungen Anwendung. Die auch in Österreich heimischen Pflanzen Berg-Gliedkraut (Sideritis montana) und Aufrecht-Ziest (Stachys recta) werden heute wohl wegen ihrer Wirkungslosigkeit nicht mehr als Heilkräuter verwendet, während verschiedene mediterrane Sideritis-Arten zunehmend populär für Teezubereitungen wurden.
Aber auch der Griechische Bergtee wird aus unterschiedlichen Sideritis-Arten hergestellt und stammt durchaus nicht nur aus Griechenland. Auf Kreta wird der Tee „Malotira“ bezeichnet und aus Sideritis syriaca subsp. syriaca, dem kretischen Eisenkraut, welches nur auf Kreta wächst, hergestellt. Der Name leitet sich von „male“ Krankheit und tira „ziehen“ ab.
Im Taygetos Gebirge auf dem Peloponnes ist die Art Sideritis clandestina vertreten, in Mazedonien S. athoa und S. raeseri in Nordgriechenland. Nach den großen Waldbränden am Peloponnes und Übererntung in endemischen Gebieten steht Sideritis clandestina auf der Verbotsliste. Sideritis raeseri mit dem natürlichen Vorkommen im mittleren und westlichen Nordgriechenland wird auch kultiviert. Sideritis scardiaca wird für Griechischen Bergtee verwendet, der auch in Albanien geerntet wird.
Allen für Griechischen Bergtee verwendeten Arten ist der hohe Gehalt an Carvacrol, einem terpenoiden Naturstoff zu eigen. Carvacrol, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-phenol ist auch in hohen Konzentrationen in Thymian, Bohnenkraut und Oregano enthalten und hat antimykotische, antibiotische und entzündungshemmende Wirkung.
Weitere bedeutsame Inhaltsstoffe sind die Flavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, die für die Farbgebung der Pflanzen verantwortlich sind und die körpereigene Abwehrkräfte durch deren antioxidative Wirkung stärken.
Der Einsatz dieser Heilpflanze reicht von Behandlung bei Gicht, Rheuma, Depressionen, Erschöpfungszuständen bis hin zu Demenz. In letzter Zeit hat der Griechische Bergtee bei der Behandlung von Alzheimer Schlagzeilen gemacht und wird als heilender Tee für das Gehirn beworben.
Jedenfalls wird Griechischer Bergtee in seinen Heimaten schon lange als wohltuender und stärkender Tee, meist mit Thymian-Honig gesüßt und mit Zimtöl aromatisiert verwendet und stellt eine Bereicherung für alle Teeliebhaber dar.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
wie an anderer Stelle versprochen, hier mein Beitrag zur Preiselbeere. Preiselbeere, Cranberry (Großfrüchtige Moosbeere) und Bärentraube sind drei verschiedene Heilpflanzen mit ähnlichem Einsatzgebiet - chronische Harnwegsinfekte und Blasenentzündungen - ich will aber heute vorwiegend die Preiselbeere als Heilkraut vorstellen:
Preiselbeere
Vaccinium vitis-idaea
Familie Heidekrautgewächse, Ericaceae
Die Preiselbeere ist in Eurasien und Nordamerika weit verbreitet. Der Gattungsname „Vaccinium“ erinnert zwar an den Begriff des Vaccins, dem Impfstoff, der sich von vacca, der Kuh ableitet (dem Pockenvirus vom Rind, der als Vaccinevirus bezeichnet wurde), stammt jedoch wahrscheinlich von „baccinium“, Latein „Beerenstrauch“, „bacca“ für Beere ab.
Der Artbeiname „vitis-idaea“ bedeutet so viel wie „Rebe vom Berg Ida“, dem in der Antike bezeichneten Berg auf Kreta. Die Bezeichnung „Rebe“ stand in der alten Botanik oft als allgemeiner Begriff für eine verholzende Pflanze, ähnlich wie „clema“ für eine rankende Pflanze steht. Oft werden diese Begriffe als „Weinrebe“ missgedeutet.
Beeren und Blätter sind ein altes Heilmittel, die getrockneten Blätter mussten früher offizinell in jeder Apotheke auf Vorrat gehalten werden. Das Wort „offizinell“ auch „offizinal“ kommt aus dem Latein und bedeutet „Zubereitungsraum, Anfertigungsraum“ und verweist auf im Arzneibuch charakterisierte Pflanzen. So tragen viele Pflanzen den Artbeinamen „officinalis“: Salvia officinalis, Lavandula officinalis, Valeriana officinalis, Paeonia officinalis, etc., was auf ihre Eigenschaften als Heilpflanze verweist.
Die Blätter der Preiselbeere tragen den Arzneibuchnamen Vitis-Ideae Folium. In ihnen steckt der wahre Wirkstoff, das Arbutin. Chemisch gesehen ist Arbutin ein Hydrochinon-ß-D-glucopyranosid und entfaltet nach der Hydrolyse im Darm seine volle Wirksamkeit als entzündungshemmendes Mittel bei Blasenentzündungen. Der Wirkstoff verhindert die Einnistung der Bakterien in den Schleimhäuten von Niere und Blase. Er ist auch in Bärentraubenblättern in noch höherer Konzentration enthalten. Die Bärentraube, Arctostaphylos uva-ursi ähnelt der Preiselbeere, darf aber nicht wild gesammelt werden, da die Pflanze selten ist und unter Naturschutz steht. Die Arzneibuchbezeichnung ist Uva-Ursi Folium.
Heute sind Bärentraubenblätter und Cranberry-Saft populärer als Preiselbeerenblätter und Preiselbeerensaft geworden, ich meine aber, dass die alte Heilpflanze Preiselbeere zu Unrecht in den Schatten getreten ist, da der Tee aus ihren Blättern verträglicher ist und als Blasentee in der Mischung mit Goldrute, Hauhechel, Birke und Kamille einen vorzüglichen Tee zur Unterstützung der Behandlung von Blasenentzünden darstellt. Aber nicht nur bei Blasenentzündungen und deren Vorbeugung finden Preiselbeerenblätter Anwendung, sie wirken auch beruhigend und Darm regulierend.
Eine Kombination aus Preiselbeerenblättertee und Saft aus den Beeren, hier kann man auch Cranberrysaft verwenden, verstärkt die heilende Wirkung. Bei der Anwendung von Bärentraubenblättertee ist Vorsicht geboten, diesen sollte man nicht länger als eine Woche trinken. Bärentraubenblättertee ist kein Haustee, sondern ein hochwirksames Arzneimittel. Die längere Verwendung einer einzelnen Teesorte ist jedoch bei allen Heilkräutern zu vermeiden.
Alle Heilkräuter können vorbeugend und unterstützend eingesetzt werden, bei fiebrigen Harnwegsinfekten ist jedoch eine Selbstmedikation mit Heilkräutern zu vermeiden und der Arzt aufzusuchen.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
heute werde ich über den Andorn berichten, den ich gerade aktuell als Tee bei beginnendem Husten und Erkältung sehr erfolgreich einsetze.
Ich bin auch gerade dabei, ein allgemeines Quellenverzeichnis meiner verwendeten Bücher (botanisch) und Internetseiten (Heilkräuterwissen) zu erstellen, aus denen ich mein Wissen beziehe. Da bitte ich um etwas Geduld, da ich immer in sehr vielen Büchern nachschlage und auf sehr vielen Internetseiten recherchiere, um mir die plausiblen und zusammenpassenden Informationen zu filtern. In Summe muss ich sagen, dass die Angabe von nachweislich falschen Aussagen oder Angaben in Druckwerken genau so groß ist wie auf Internetseiten, was wohl daran liegt, dass auch im Internet auf Quellen der Druckwerke zurückgegriffen wird und falsche Dinge ungeprüft abgeschrieben werden. Aber selbst in streng geprüften wissenschaftlichen Publikationen werden falsche Aussagen oft über Generationen hinweg einfach abgeschrieben.
Betrachtet daher meine Angaben zu den hier vorgestellten Heilpflanzen als meine persönlichen Erfahrungen und mein persönliches Wissen, welches ich mir über einen längeren Zeitraum erworben und angelesen habe und nicht als quellenzitierbare Publikation.
Dennoch bin ich daran, die meiner Meinung nach besten Quellen zusammenzustellen und bei Interesse hier anzugeben.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Johannes1956
-
 Autor
Autor
- Offline
- Vereinsmitglied
-

- Beiträge: 1583
- Dank erhalten: 886
Familie Lippenblütler, Lamiaceae
Der gewöhnliche Andorn ist eine uralte Heilpflanze, deren Verwendung bis in die Jungsteinzeit 4000 v. Chr. zurückverfolgt werden kann. Entsprechend vielfältig sind seine Volksnamen wie Helfkraut, Feeweibel, Alte Weiber, Brustkraut, Lungenkraut, welche bereits auf die Anwendung als helfendes Kraut bei Bronchitis und anderen Lungenerkrankungen hinweist.
Aber seine Heilkraft erstreckt sich darüber hinaus auf die Verdauungsorgane und bei äußerlicher Anwendung auch bei Ekzemen. Seine Eigenschaften bei innerlicher Anwendung sind appetitanregend, harntreibend, magenstärkend, hustenstillend und reichen von Verwendung bei Appetitlosigkeit, Bronchitis, Nebenhölenentzündungen, Rachenentzündungen, Asthma, Blähungen und noch viel mehr.
Der botanische Gattungsname leitet sich aus dem Häbräischen von mar für bitter und rob für viel ab und beschreibt trefflich den sehr bitteren Geschmack des frischen Saftes aus seinen Blättern, aber auch des Tees aus getrockneten Blättern und Blüten. Der Artbeiname vulgare bedeutet gewöhnlich.
Im Englischen heißt er „horehound“ und die Etymologie ist umstritten. Manche Quellen beziehen sich auf eine Ableitung von der Verwendung des Andorn als „antidote to bite of a mad dog“, andere verweisen auf den Namen „Seed of Horus“ der alten Ägyprischen Priester und leiten den Namen von Horus, dem Ägyptischen Sonnenkönig ab.
In der germanischen Mytologie wird ein von Donars Blitz getroffenes Pflanzenwesen beschrieben, welches den Tod eines ungläubigen Menschen verhindert hat und so würde die Kraft des Blitzes im Andorn stecken.
Auch die Herkunft des deutschen Namens ist umstritten, die einen meinen, er leite sich von „ohne Dornen“ ab und damit würde eine Pflanze beschrieben werden, die ähnlich wie eine Nessel oder Brennessel aussähe, aber keine Dornen, schmerzenden Brennhaare hat, die anderen meinen, dass sich die dornigen Anhänge der Fruchtstände an Tieren festheften und so zur Verbreitung beitragen.
Eine derart alte Heilpflanze, um die sich zahlreiche Mythen und damit verbundene Wortbedeutungen ranken, kann freilich auf eine lange Erfahrung der medizinischen Verwendung zurückblicken und heute ist die Heilkraft auch wissenschaftlich belegt. Der wichtigste Wirkstoff ist das Marrubin, ein Diterpenlacton der Labdanreihe. Marrubin regt, wie auch andere Bitterstoffe, die Gallenproduktion und die Wassersekretion der Bronchialmukosa an.
Andorn wächst an Ruderalstellen und Wegrändern, auf Schuttplätzen und in der Nähe von Stallungen, ist aber in freier Wildbahn nur noch selten anzutreffen. Er lässt sich jedoch leicht kultivieren und ist fixer Bestandteil eines Heilkräutergartens.
Er findet Verwendung als frisch gepresster Blättersaft im Frühling, als Tee aus den getrockneten Blättern und Blüten im Sommer, für Umschläge und als Räucherware. Beim Räuchern soll er angespannte Stimmung unter Menschen in einem Raum lösen.
Die Arzneidroge der getrockneten Blätter und Blüten ist in jeder Apotheke unter dem Drogennamen „Marrubii herba“, Andornkraut geschnitten, erhältlich.
Bei Beschwerden mit Husten, Erkältung oder Verdauung nehme ich ein bis zwei Teelöffel für eine Tasse Tee und lasse den Aufguss 10 Minuten ziehen. Schluckweise getrunken gewöhnt man sich sehr rasch an den wohlig bitteren Geschmack. Man kann auch einen Hustensaft herstellen, indem man 1 ½ Tassen Wasser mit 1 Tasse Andornkraut kocht, 10 Minuten ziehen lässt, dann abgießt und ¾ Tasse Honig darin auflöst. Diesen Sirup kann man eine Zeit im Kühlschrank lagern und man nimmt im Bedarfsfall 2 Teelöffel 2x am Tag, maximal eine Woche lang.
Hildegard von Bingen empfiehlt einen Andorn-Kräuterwein aus Fenschelsamen, Dillkraut, Königskerzenblüten und Andornkraut mit Wein gekocht bei grippalen Infekten und Fieber.
Wie bei allen Arzneipflanzen ist der Einsatz mit Bedacht zu wählen, eine länger andauernde Einnahme (eine Woche bis 14 Tage) ist zu vermeiden und auf mögliche Nebenwirkungen zu achten. Bei anderen vorliegenden Erkrankungen oder Einnahme von anderen Medikamenten soll eine Rücksprache mit Arzt und Apotheker gehalten werden. Überdosierung kann zu Herzrhythmusstörungen führen, in der Schwangerschaft und während des Stillens darf Andorn nicht eingenommen werden.
Johannes
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Inkontinenz Forum
- Inkontinenz Forum - Harninkontinenz - Stuhlinkontinenz - Hilfsmittel
- Forum: Allgemeines zur Inkontinenz
- Heilkräuter
Neue Artikel
Inkontinenz Selbsthilfe e.V.
Die Inkontinenz Selbsthilfe e.V. ist ein gemeinsames Anliegen vieler Menschen. Der Verein versteht sich als ein offenes Angebot. Unsere Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich. Den Verein bewegt, was auch seine Mitglieder antreibt: Wir möchten aktiv zur Verbesserung der krankheitsbedingten Lebensumstände beitragen.
Impressum Kontakt Datenschutzerklärung
Spendenkonto:
Volksbank Mittelhessen eG
Inkontinenz Selbsthilfe e.V.
IBAN: DE30 5139 0000 0046 2244 00
BIC: VBMHDE5FXXX
Besucher: Sie sind nicht allein!
Heute 279
Gestern 2614
Monat 56658
Insgesamt 9936557
Aktuell sind 194 Gäste und keine Mitglieder online
Alle Bereiche sind kostenfrei, vertraulich und unverbindlich. Wenn Du erstmalig eine Frage im Forum stellen möchtest oder auf einen Beitrag antworten willst, ist es erforderlich sich sich zuvor zu registrieren. Bitte sei bei der Auswahl deines Benutzernamens etwas einfallsreich. Häufig verwendete Vornamen sind normalerweise schon vergeben und jeder Name kann nur einmal vergeben werden. Achte auf korrekte Eingaben bei Passwort, Passwortwiederholung und existierender Mailadresse! (Die Freischaltung kann bis zu 36 Stunden dauern!)
Jetzt kostenfrei registrieren